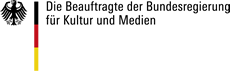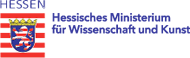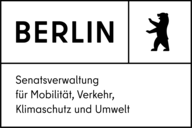Tagung am 7. November 2024
Ein Garten für die Lebenden und die Toten
Friedhöfe - Aufgaben und Bedeutung im Wandel
Von Svenja Schmidt und Anna Lischper
Die Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. in Kassel und die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e.V. (DGGL) in Berlin luden am 7. November zu einer gemeinsamen Tagung in das Museum für Sepulkralkultur ein. Ein Bericht.
Spricht man vom „letzten Garten“, klingt bereits das Leben an. Ein solcher Garten will gepflegt werden – zum Beispiel, um den Toten etwas zurückzugeben, für das, was man zu Lebzeiten von ihnen empfangen hat. Doch der letzte Garten mit seiner Funktion als sozialer, soziologisch bezeichneter „dritter Ort“, ist auch ein Ort für die Lebenden. „Der Friedhof ist für alle da – ob dort Gräber gepflegt werden wie bei uns oder ob Mumien zu Festtagen neue Anzüge verpasst werden, wie in der Kapuzinergruft in Palermo“, sagte Dr. Dirk Pörschmann, Direktor des Museums für Sepulkralkultur und Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal, zu Beginn der Tagung. Jürgen Rohrbach, Bundesschatzmeister der DGGL, bezeichnete den Friedhof in seiner Moderation als traditionsreichen Ort, der jeden betrifft. „Er übernimmt eine wichtige, soziale Funktion als letzter Garten und grüner Ort – insbesondere im Kontext des Klimawandels“. Der Friedhof sei eine Kulturlandschaft mit Wechselwirkung zwischen Naturgegebenheiten und menschlichen Einflüssen. Um diese Kulturlandschaft drehten sich die folgenden Beiträge unterschiedlicher Referenten – im Folgenden zusammengefasst.
Dr. Martin Venne, Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e. V. und Geschäftsführer des Planungs- und Beratungsbüros PLANRAT VENNE in Kassel gab eine breite Einführung in die Gesamtproblematik der Friedhofsplanung sowie des Themas den „letzten Garten“ planen. „Wie kann Friedhofsgestaltung langfristig funktionieren und wie kann, beziehungsweise muss sich die Friedhofsplanung in den nächsten Jahren entwickeln?“. Es müssen individuelle Lösungen her, so Martin Venne. Bis zum Jahr 2052 sei mit steigenden Sterbezahlen in Deutschland zu rechnen – dafür benötige man Flächen und Anlagen, die gut strukturiert und attraktiv seien. Friedhöfe seien gestaltete Grünräume – multifunktionale Orte, Orte des Lebens, der Heimat und vieles mehr. „Sie sind kleine Städte“, so Venne. Jeder Friedhof ist anders – doch in einem sind alle gleich: Sie sind Orte zum Trauern, in Erinnerungen schwelgen und Kommunizieren. „Ich bin nicht alleine“, sagte Venne, „wenn ich auf einem Friedhof bin“. Friedhöfe seien wichtig und müssten sich in den kommenden Jahren verändern, damit sie wieder mehr an Attraktivität gewinnen.
So muss laut Venne ein Umdenken stattfinden in der Gestaltung und der Anlage selbst. Wie sind die Gräber platziert? Ist eine Aufenthaltsqualität geschaffen? Ist der Friedhof ein attraktiver Ort, um der letzte Garten der Verstorbenen zu sein? Um diese Fragen umsetzen zu können, benötigten Friedhöfe eine gute Beratung, eine langfristige Planung, finanzielle Mittel und eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Gleichzeitig hat kaum ein Friedhof die finanziellen Mittel, um eine gute Öffentlichkeitsarbeit leisten zu können und so auf sein Angebot aufmerksam zu machen. Dies ist nicht zuletzt darin begründet, dass in den letzten Jahren vermehrt auf alternative Bestattungsformate, wie beispielsweise Waldbestattungen, zurückgegriffen wird. Die Erhöhung von Friedhofskosten, um die Instandhaltung des Friedhofs zu sichern, stoße jedoch auf Widerspruch, da die Leistbarkeit für einen Platz bei Vielen nicht mehr gegeben wäre. Was passiert, wenn die Kassen leer sind? Friedhöfe müssen schließen, was auch auf Widerstand in den betroffenen Stadtteilen treffe. Schließungen von Teilflächen würden akzeptiert, sofern die Nachbelegung der vorhandenen Grabstätten gesichert sei. Die Friedhöfe benötigten Öffentlichkeitsarbeit, besonders einen guten Internetauftritt. Aktuelle Informationen müssten sofort abrufbar sein, es brauche eine gute und frühzeitige Friedhofsentwicklungsplanung, regelmäßiges Controlling, bezahlbare Gebührensätze, eine eindeutige, nachfrageorientierte Ausrichtung der Bestattungsangebote und Kontaktpflege zu wichtigen Instanzen.
Rechtsanwältin Farnaz Punke und Rechtsanwalt Henning Walter gaben in ihrem Vortrag komprimierte Einblicke zur Frage: Quo Vadis Friedhofs- und Bestattungsrecht? Grundsätzlich unterliege in Deutschland das Bestattungsrecht dem Polizei- und Ordnungsrecht. Darüber hinaus gebe es Unterschiede zwischen den Bundesländern, jedoch keine bundesweiten Regeln im Bereich des Friedhofs- und Bestattungsrechts. Die rechtliche Grundlage unterliege bei allen Bundesländern der Menschenwürde – dem postmortalen Persönlichkeitsrecht als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Die Auslegung sei allerdings Ländersache. Grundlage aller Bundesländer sei: Der Leichnam darf nicht herabwürdigend oder in lächerlich machender Weise behandelt werden. Jeder Tote hat das Recht auf eine würdige Totenruhe und ein würdiges Begräbnis.
Gleichzeitig gebe es jedoch viele Abweichungen zwischen den Bundesländern, wie beispielsweise bei der Bestattungsfrist und der Leichenschau. Doch gibt es hier schon erste Änderungen? Punke und Walter bestätigten, dass es erste gesetzliche Entwicklungen gebe, die sich an einem Wandel orientierten. Dennoch sei bei jeder einzelnen Änderung eine Vermessungsentscheidung zu treffen.
Letztendlich werde kein Wandel in der gesetzlichen Pflicht der „traditionellen“ Bestattungsorte und Bestattungsarten sichtbar: „Wir können keinen Wandel erwarten! Die Regeln bleiben bestehen. Nur Ausnahmen werden akzeptiert“, so die beiden Referierenden. Die Ausnahmen würden besonders bei Bestattungen anderer Religionen gelten und müssten im Vorhinein beantragt und genehmigt werden. Ein kleiner Ausblick sei, dass sich immer mehr Versuche zu Gestaltungsspielräumen und gesetzlichen Regelungen entwickelten. Würde der Friedhof lediglich als ein Ort der sicheren Bestattung betrachtet werden, wären auch Wälder und andere alternative Bestattungsmöglichkeiten unproblematisch.
Frederike Dirks, Doktorandin im Bereich Nachhaltigkeit und Bestattung an der Uni Hamburg, zeigte in ihrem Vortrag „Der Friedhof als Ort der Integration“ die verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten anderer Religionen in Deutschland und die Relevanz eines Wandels auf.
In ihrem Vortrag beschränkte sie sich auf die Religionsgruppen Judentum, Muslime, Yezid:innen, die italienische Community sowie buddhistische und hinduistische Grabfelder. Die Vergänglichkeit eines Jeden eint alle Menschen ab ihrer Geburt. Es sei das gemeinsame Schicksal – irrelevant, welche Hautfarbe, religiöse Zugehörigkeit, Weltvorstellung und finanzielle Mittel existieren. „Wir sterben alle – das eint uns!“, sagte Dirks. Die Corona-Zeit habe die Menschen sensibilisiert und gezeigt, dass die traditionelle Sicht der verschiedenen Bestattungen sehr schwierig und verschieden sein könne – dennoch sehr relevant ist. So gab es zu Pandemie-Zeiten Beschränkungen bei Beerdigungen, sodass sich nicht alle Menschen von den Verstorbenen verabschieden konnten oder die Beerdigung nicht so stattfand, wie es ihnen Trost gespendet hätte. Dieses Gefühl verdeutlichte, wie sich andere Religionen in Deutschland fühlten, die ihre Beerdigungsriten hier gar nicht oder nur bedingt in gewohnter Form umsetzen dürften. Doch seien bereits immer mehr Tendenzen erkennbar, dass Offenheit entstehe und Kompromisse geschaffen würden. In Deutschland gebe es jüdische Friedhöfe, muslimische Grabfelder, buddhistische und hinduistische Grabfelder, Beerdigungen von Yezid:innen sowie italienische Grabfelder. Bei all diesen Friedhöfen beziehungsweise Abteilungen sei ein großer Teil der gewünschten Beerdigungsriten möglich, auch wenn noch nicht alle. Ein Wandel sei deutlich zu erkennen. Daraus lasse sich schließen, dass in Deutschland eine große Diversität, Heterogenität und Multikulturalität bestehe. Ein Austausch und eine Entwicklung in den Bestattungskulturen seien erkennbar und auch nötig. „Wenn der Friedhof dafür kein perfekter Ort ist, welcher wäre es dann?“, so Dirks.
Dr. Ingo Kowarik, zuletzt Professor für Ökosystemkunde und Pflanzenökologie an der TU Berlin, sprach zum Thema „Biodiversität und Klimabedeutung von Friedhöfen“. Man befinde sich in einer „stillen Krise“: Die sensorische Naturerfahrung insbesondere bei Kindern und Jugendlichen gehe zurück und zugleich sei der Zugang zur Natur limitiert. Dabei sei es gerade dieser, der sich positiv auf die Gesundheit auswirke, für Naturverbundenheit sorge und schließlich zu umweltfreundlichem Verhalten führe. Mit seiner Biodiversität sei der Friedhof eine Plattform um sich die sensorische Naturerfahrung anzueignen. Sowohl Tiere als auch Pflanzen finden ein Habitat auf dem Friedhof. Alte Bäume, Gehölze, Hecken, Büsche, aber auch Grünflächen, Seen und Teiche sowie Felsen, Mauern und Pflasterungen machten den Friedhof zu einem wichtigen Lebensraum und seien innerhalb von Städten zugleich Kühle-Inseln in überwärmten Gebieten der Innenstadt. Aber: Auch dieser Ort sei vom Klimawandel betroffen und es gelte, ihn zu erhalten. Für die vielseitige Bedeutung von Friedhöfen spreche auch eine Studie von 2022, nach der der Friedhof gleichermaßen aus Gründen der Trauer und sowie aus Freude an der Natur besucht werde. „Insbesondere in verdichteten Stadtgebieten sollten Friedhöfe erhalten und entwickelt und eine bauliche Nachnutzung vermieden werden", stellte der Experte abschließend klar. Auf betriebenen Friedhöfen und bei „grüner Nachnutzung“ sollten Biodiversität, Naturerlebnis sowie Umweltbildung und Klimaausgleich gefördert werden. Schließlich empfahl Kowarik eine Entschädigung von Friedhofsbetreibern für Leistungen, die diese für die Allgemeinheit erbrächten.
Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.
Zentralinstitut für Sepulkralkultur
Museum für Sepulkralkultur
Weinbergstraße 25–27
D-34117 Kassel | Germany
Tel. +49 (0)561 918 93-0
info@sepulkralmuseum.de